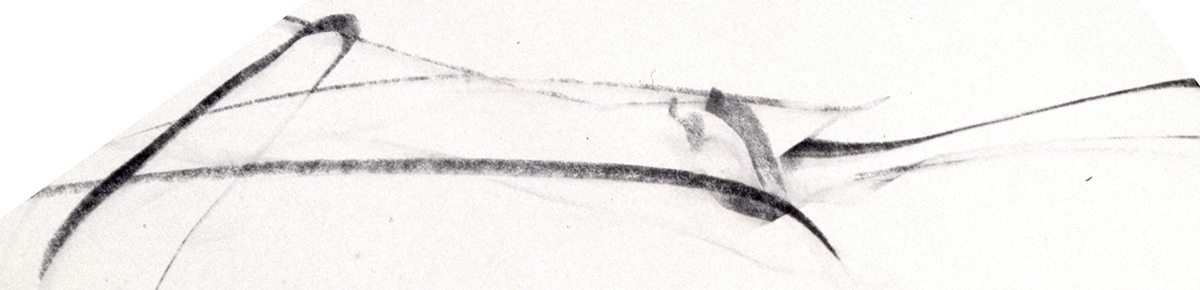"Angelo Garoglio" von Pino Mantovani
für „Disegno della Scultura“ (Gestaltung der Skulptur), 2025
Thema der folgenden Überlegungen ist die Beziehung zwischen Skulptur und Fotografie: Zum einen wird untersucht, wie die Bildhauer Auguste Rodin und Medardo Rosso in der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Fotografie im Rahmen ihrer Arbeit einsetzten; zum anderen, wie der Künstler Angelo Garoglio heute die Sprache der Fotografie nutzt, um das Werk der beiden Bildhauer zu analysieren. Durch die Sprache der Fotografie analysiert er auch die Werke anderer Bildhauer von der Romanik bis zur Renaissance, insbesondere Donatellos Magdalena und seine Kanzeln in San Lorenzo sowie Michelangelos „Battaglia d'ignudi“ (Schlacht der nackten Männer) in der Casa Buonarroti und seine Pietà-Statuen, vor allem die Problematik im Zusammenhang mit der Bandini-Pietà und der Rondanini-Pietà. Zu dieser Zeit war die Fotografie noch zeitlich weit entfernt, doch Fragen des Bildausschnitts, der Beleuchtung und vor allem des Blickwinkels waren in der Bildhauerkunst bereits von wesentlicher Bedeutung. Hervorzuheben ist auch, dass Garoglio seine kritische Analyse mit der Absicht ergänzt, seine eigene Einstellung zur und Konzeption der Bildhauerei zu definieren, besonders wenn sie mit verschiedenen, herkömmlichen oder nicht-herkömmlichen Techniken und Materialien betrieben wird.
Alle Themen in Einklang zu bringen, wird eine anspruchsvolle Aufgabe sein. Die Vielfalt der Aspekte könnte nämlich zerstreuend wirken, und die Argumente könnten unterschiedliche Wege einschlagen, wenn es nicht ein Element gäbe, das alle Themen zu einem einzigen Knoten zusammenbindet. Dieses Element ist das Licht. Das Licht trägt dazu bei, das Bild zu definieren, es gestaltet die Form, löst die Figur in Atmosphäre auf, fasst die Räumlichkeit mit dem plastischen Objekt zusammen und verschmilzt sie mit dem umgebenden Raum. Außerdem verdeutlicht es die Wahrnehmung sowohl für den Autor als auch für den Betrachter und macht sie gleichzeitig komplexer. In Kürze gesagt, Licht ist die Bedingung für die visuelle Beziehung und bildet die (nicht nur symbolische) Grundlage für Wissen und sogar für kreatives Schaffen. In der Bildhauerei wird dies am deutlichsten, wenn sie von der Fotografie (Lichtschrift, Lichtzeichnung) angeregt wird, wenn diese ihre eigenen Mittel und Möglichkeiten bewusst einsetzt, um das plastische Bild umzugestalten oder es sogar als immaterielle Artikulation des Lichts wiederzugeben.
Die hier gesammelten Überlegungen beanspruchen weder, systematisch oder gar abschließend zu sein, noch zu einem bestimmten wissenschaftlichen oder historischen Bereich zu gehören. Ausgehend von einem Text von Yves Bonnefoy, den der Bildhauer und Fotograf Garoglio – das Objekt und vor allem das Subjekt der vorliegenden Untersuchung – selbst vorschlägt, zielen sie vielmehr darauf ab, Licht in ein Gebiet zu bringen, in dem sonst die Dunkelheit und die Langeweile der Banalität den Sinn des künstlerischen Strebens verschlucken würden, das nicht nur auf das bloß messbare Deutliche reduziert werden kann und darf. Es darf auch nicht auf die physische Auseinandersetzung zweier gegensätzlicher Themen beschränkt werden: das der sogenannten unbewussten Natur und das der Verantwortung des menschlichen Schöpfers.
So lauten die Verse von Bonnefoy aus Ce qui fut sans lumière (Was ohne Licht war): „… On dit que la lumière est un enfant/ Qui joue, qui ne veut rien, qui rêve ou chante/ Si elle vient à nous, c’est par jeu encore,/ Touchant le sol d’un pied distrait, qui serait l’aube.” (Man sagt, das Licht sei ein Kind/ Das spielt, das nichts will, das träumt oder singt/ Wenn es zu uns kommt, so wieder aus Spiel/ Den Boden berührend mit einem flüchtigen Fuß, der die Morgendämmerung bringt.)
Das Licht verleiht also der Skulptur Leichtigkeit und bewahrt sie vor der allgegenwärtigen Gefahr, von der Schwere, der Dicke, der Härte und der Stumpfheit der Materie aufgesogen zu werden. Es belebt nicht nur die Oberfläche und betont ihre Diskontinuität, sondern es zieht auch die materielle Masse mit sich und lässt sie im Raum schweben, was entscheidend dazu beiträgt, ihr unmittelbares Wesen in eine plastische Form zu übertragen. Bonnefoy – nicht umsonst ein scharfsinniger Beobachter von Alberto Giacometti, einem der modernen Bildhauer, deren Werke am öftesten aus einer phänomenologischen Perspektive interpretiert werden – legt dies poetisch dar. Medardo Rosso zeigt und beweist dies ebenso poetisch und deutlich, zum Beispiel durch seine lachenden Kinder, die das „rire“ zu einer seiner verführerischsten plastischen Schöpfungen machen; gerade weil er die Materie der aggressiven Liebkosung des Lichts aussetzt. Mir fallen nur wenige Beispiele aus der Geschichte der Bildhauerei ein, die mit Rossos lachenden Skulpturen verglichen werden können, vor allem ein Kind von Desiderio da Settignano in Wien. In seinen enfants verleiht Medardo dem Licht Substanz, indem er die Natur des Wachses nutzt; jedoch wirkt die Natur des Wachses nicht dominierend. Stattdessen entfesselt der Kunstgriff des freien Modellierens das im Wachs (oder auch in Bronze oder Gips: entscheidend ist nicht das Material, sondern der erzeugte visuelle Effekt) verborgene Potenzial des Lichts, ähnlich wie die Bewegung den schillernden Glanz der Seide hervorhebt. Die Fotografie greift genau dort ein, wo sich das Wunder ereignet, und enthüllt es gewissermaßen, indem sie die Menge und Beschaffenheit der durch den Schnappschuss/die gründliche Bearbeitung erzielten Effekte als Schlüssel nutzt und dabei Lichtvariationen stimuliert. So führt sie den Prozess der Überwindung – der Auflösung – der Materie in Licht weiter. Wenn Medardo in seinen Fotografien eingreift – auch in denjenigen, die er nicht selbst aufnimmt –, verhält er sich eher wie ein Maler, der die Oberfläche der Figur „durcheinanderbringt“, als wie ein Bildhauer, der die Absicht hat, deren Struktur zu verdeutlichen oder zu verändern. Es sei denn, man betrachtet, wie in Medardos Fall, den Autor der Geste, die das Material in Abhängigkeit von dessen Reaktion auf das Licht und im Auge des Betrachters belebt, ebenfalls als Bildhauer. Beim Eingreifen löst Medardo die Dicke und Schwere des Bildes in Licht auf – im eindringenden lux, der blendenden anima mundi. Das Licht verzerrt sich im Enfant au soleil (Kind in der Sonne) in einer vagen Gegenbeleuchtung und sucht im Enfant juif (Jüdischen Kind) die faszinierenden Abstufungen des Schattens, oder besser gesagt, des „Im-Schatten-Bleibens“ – wie der Autor seiner Freundin Wanda im Begleitbrief zu seinem Werk empfiehlt. Im Gegensatz dazu betont Garoglio die phantomhafte Natur des Bildes, indem er die Wirkung des besonderen Lichts auf die raue Oberflächentextur „übertreibt“. Indem er sich auf das Lumen konzentriert – „die Energie, die auf die Körper ausgestrahlt wird, die sie reflektieren“ – und auch zufällige Lichter nutzt, die dem aufgenommenen Gegenstand „übermäßig“ nahe sind, erreicht er eine „Dinglichkeit“, die quasi-absolut, substanziell in all ihren Aspekten und in diesem Sinne immer noch unnatürlich wirkt.
Aus diesem Grund richtet Garoglio sein Interesse auf Auguste Rodin, der nicht vorhat, auf die Skulptur oder vielmehr auf deren Monumentalität zu verzichten und selbst ein Fragment in ein Monument verwandelt. Rodin setzt die Fotografie ein, um die bildhauerischen Probleme, die Baudelaire als unlösbar bezeichnet, besser zu definieren und zu lösen. Vor allem in den Achtziger- und Neunzigerjahren verwendet er in zahlreichen Einzelbildern von Skizzen, an denen er arbeitet, deutlich vertiefte, fast kraftvoll gedruckte, anregende Zeichen, um zu markieren, wo ein Schatten verstärkt, ein Teil hervorgehoben oder abgeschwächt oder eine Bewegung unterstrichen werden muss. In diesem Zusammenhang ist er sich der Bedeutung des Blickwinkels und des Lichts für die Wahrnehmung des plastischen Bildes bewusst. Die Fotogramme nehmen jedoch bereits eine plastische Form an, nicht nur im virtuellen Sinne, da die darauf befindlichen Zeichen klar und objektiv erkennbar sind und manchmal durch chemische Substanzen oder Gouache-Zusätze verstärkt werden, die Unterschiede in der Konsistenz und Tiefe des fotografischen Bildes bestimmen.
In einem interessanten Essay mit dem Titel „Dans l'atelier – L'œil du photographe – Le regard de Rodin“ (Im Atelier – Das Auge des Fotografen – Der Blick Rodins) schreibt Hélène Pinet:
„Ces images sont comme un cours de sculptures. Il est passionnant de découvrir les différentes étapes de la création dont seule la photographie a gardé une trace. Surtout, ces images dévoilent les pratiques les plus innovantes de Rodin : l’assemblage de figures appartenant à de groupes différents pour former une œuvre nouvelle ; la liberté avec laquelle une mème œuvre peut être présentée dans de positions différentes, et ce qui a le plus choqué le public de l’époque la présentation de fragment comme œuvre à part entière. […] Rodin, qui prend plaisir à multiplier à l’infini ses sculptures, les traduit, grâce à la photographie, en un langage artistique nouveau et différent. Il soumet le tirage à son imagination et obtient une œuvre hybride mi-photo mi-dessin. Il transforme et enrichit par cet usage l’interprétation de la sculpture …”. (Diese Bilder wirken wie ein Bildhauerkurs. Es ist faszinierend, die verschiedenen Phasen des Schaffens zu entdecken, die nur dank der Fotografie eine Spur hinterlassen haben. Vor allem aber zeigen diese Bilder die innovativsten Methoden Rodins: die Kombination von Figuren aus verschiedenen Gruppen zur Schaffung eines neuen Werkes; die Freiheit, mit der ein Werk in verschiedenen Positionen präsentiert werden kann; und schließlich die Präsentation eines Fragments als Gesamtwerk, was das damalige Publikum stark verblüffte. [...] Rodin, der Freude daran hat, seine Skulpturen unendlich zu vervielfältigen, übersetzt sie durch die Fotografie in eine andere, neue künstlerische Sprache. Er lässt sich von seiner Vorstellungskraft leiten und schafft ein hybrides Werk, halb Foto, halb Zeichnung. Damit verwandelt und erweitert er die Interpretation der Skulptur ...). In Kursivschrift habe ich eine von Garoglio kommentierte Passage abgeschrieben, die er am Rande des zitierten Textes deutlich als „non photo – non dessin" (Nicht-Foto – Nicht-Zeichnung) bezeichnet, angesichts des darauf folgenden Satzes von Pinet, die das Essay im Übrigen mit der folgenden Feststellung abschließt: „Tout ce que Rodin formulera par la suite à propos de son art dans des ouvrages comme l’Art de Gsell, les Entretiens de Dujardin-Beaumetz ou encore par l’intermédiaire de Rilke, se trouve déjà illustré sur ces images : importance du modelé, de la lumière, du choix d’un point de vue et aussi de l’atmosphère. Elles nous révèlent non seulement une série de moments, fugitifs, mais aussi les étapes transitoires de la création qui ont été détruites au fur et à mesure que l’œuvre prenait forme, et en rétablissent la continuité”. (Alles, was Rodin später in Werken wie l'Art de Gsell (Gsells Kunst), les Entretiens de Dujardin-Beaumetz (Die Gesprächen von Dujardin-Beaumetz) oder durch Rilke über seine Kunst formuliert ist bereits auf diesen Bildern dargestellt: die Bedeutung des Modellierens, des Lichts, der Wahl des Blickwinkels und der Atmosphäre. Sie offenbaren uns nicht nur eine Reihe flüchtiger Momente, sondern auch die vorübergehenden Phasen des Schaffens, die während der Entstehung des Werkes verloren gehen; und sie stellen die Kontinuität wieder her.)
Selbstverständlich ist ein Druck auf leicht koloriertem Albuminpapier, das mit mehr oder weniger eingravierten Markierungen und deckenden Gouache-Zusätzen versehen ist, keine eigentliche Skulptur. Es ist jedoch wie bei der Bildhauerkunst: „verschiedene Ebenen zu schaffen, die durch das reflektierte Licht der Albuminoberfläche eine Dimension hervorbringen.“ Dies gilt auch für einen anderen Bildhauer, Angelo Garoglio, der beim Fotografieren einer Fotografie von Rodin das Modell schief aufnimmt, den Einfall von Neonlicht nutzt und sogar eine starke Unschärfe einsetzt, um die plastische Qualität des fotografierten Gegenstands zu betonen.
Das erinnert daran, dass die beiden von Rosso und Rodin verwendeten Varianten, die durch die entsprechenden Methoden der fotografischen Aufnahme veranschaulicht werden, bereits von Baudelaire (Schutzgottheit beider Künstler, die Garoglio durch Bonnefoy kennen lernt) vorgesehen waren. Baudelaire nennt Verdampfung und Konzentration als zwei gleichermaßen wirksame Strategien der Moderne, um dasselbe Ziel zu erreichen: die Auflösung des Realen. Es geht darum, die einfache Weltanschauung in eine Krise zu stürzen, die Positivismus und Verismus im Namen der Klarheit als Schutzschild gegen den Ansturm der Gefühle und die Angst vor dem Chaos errichtet haben.
So schreibt Medardo Rosso, während er über die bekannte Episode nachdenkt, die an einem glücklichen Tag in seiner Jugend in Brera stattfand:
„Eine Emotion ist wie ein Augenblick, der aufblitzt und sofort verfliegt; der Künstler folgt ihr und ruft ihr zu, sie solle nicht weggehen. [...] Ich war jung und erkannte, dass es im Raum nichts Materielles gibt; alles ist Raum, also ist alles relativ“.
Diese Einsicht führte bei Rosso zu einer Intuition und später, in seiner künstlerischen Reife, zu seiner Serialität – und zwar nicht im Sinne einer Wiederholung des Gleichen, sondern als Abfolge gleichwertiger Varianten. Das Thema wird in einem originellen Essay des Musikwissenschaftlers Enzo Restagno behandelt, der sich dabei auf die Variation in der Musik bezieht. Im Allgemeinen geht er jedoch vom Prinzip der ständigen Metamorphose der Materie aus, „die sich nicht mehr nach den herkömmlichen Koordinaten im Raum anordnen lässt.“ Seine Argumentation basiert auch auf dem „Streben der Materie, Einklänge in dem vibrierenden Wesen zu schaffen, das der Mensch ist“. Dies würde eine tiefe Affinität sowie eine intuitive Kontinuität zwischen Medardos Skulptur und einerseits der Musik, andererseits der Fotografie verdeutlichen. Tatsächlich widmete sich Medardo Rossi in den letzten zwanzig Jahren seines Lebens der Fotografie seiner Skulpturen. In dieser Zeitperiode strebte er an, die theoretischen Grundlagen und die Bedeutung seiner Skulptur zu definieren. Dieses Thema wird von Francesca Bacci in ihrem bemerkenswerten Essay im Katalog „De visu – Medardo Rosso/Angelo Garoglio“ für die gleichnamige Ausstellung in der Galerie für moderne Kunst Oddi Ricci in Piacenza, 2014, mit überzeugenden Argumenten untersucht: „Abstand zur Skulptur, Beobachtungspunkt, Einfallswinkel und Lichtintensität – die Variablen, deren Unkontrollierbarkeit Rosso nicht akzeptieren konnte – finden alle miteinander ihr Maß der Vollkommenheit in der Dauerhaftigkeit des fotografischen Schnappschusses und sind somit ein für alle Mal vom gnadenlosen subjektiven Beurteilen des Betrachters befreit. Medardo Rosso behandelte die Bilder seiner Skulpturen, als wären sie der letzte und bedeutendste Ausdruck seines Schaffens“.
In demselben Essay werden die Verfahren ausführlich beschrieben, die der Bildhauer in seiner Rolle als exklusiver directeur d’image (Bildregisseur) bei der Vorbereitung der Aufnahmen und der Bearbeitung der Negative anwendet.
Diese Problematik kann auch als Ausgangspunkt für eine andere Erfahrung dienen, initiiert durch den Bildhauer A. Rodin und kritisch reflektiert vom Literaten R. M. Rilke, der ihm eine Zeit lang nahe war. Einzelne Momente sind wie Punkte, die vom Schnappschuss festgehalten werden. Unwiederholbar, können sie eine Linie bilden, die manche als Kraftlinie bezeichnen: die Kontinuität einer Geste. Ich zitiere hier Gino Gorza, einen Künstler und aufmerksamen Rilke-Leser, der Rodin die Erfindung der Geste zuschreibt – im Gegensatz zum traditionellen, rhetorisch aufgeladenen Verhalten, das für die Skulptur typisch ist. Sehr prägnant und treffend formuliert er seine Gedanken, natürlich aus der Perspektive eines Künstlers: „Die Geste ist die dynamische Ausdrucksform einer Energie, die sich aus der Beziehung des Subjekts zu sich selbst und zur Umwelt ergibt. Die verschiedenen Formen der Geste, ob freiwillig oder unfreiwillig, sind Ausdrücke, gekennzeichnet durch den Körper als psychologische Indizien oder Äußerungen. Die Gestik ist mit unterschiedlich kodierten, expressiven und kommunikativen Bedeutungen eng verknüpft. Die Linearität der Geste ermöglicht das Schreiben und Zeichnen auf der gemeinsamen Matrix der Bewegungsspuren“.
Der Beitrag des Fotografen Garoglio zu diesem Thema – der Zeit des Bildes – zeigt sich in den Aufnahmen der „Bürger von Calais“, der Gipsfiguren im Ca' Pesaro, der Bronzefiguren im Rodin-Museum, des „Großen Schattens“ und einiger Terrakotta-Skizzen zum Thema Tanz. Außerdem ist er in einer Reihe von „Fotos nach Originalfotografien“ erkennbar, die, wie bereits erwähnt, von Rodin selbst gezeichnet und bearbeitet wurden.
Die Aufnahmen, die die Figuren von Pierre de Wissant und Andrieu D'Andres getrennt abbilden und die Aufmerksamkeit auf die rechte Hand des einen sowie auf die ineinander verschränkten Hände des anderen lenken, erinnern an Rilkes Beobachtungen zur Geste bei Rodin. Sie verdeutlichen nämlich den engen Zusammenhang zwischen der Geste des Arms und der Verzweigung der Hand einerseits und der Wechselhaftigkeit der umgebenden Pflanzenwelt andererseits. Wo die Umgebung keine wichtige Rolle spielt (wie bei den Aufnahmen in der ‚mumifizierten Situation‘ im Ca' Pesaro), eröffnen sie stattdessen einen engen Dialog zwischen der Hand und den anderen Körperteilen, insbesondere dem Gesicht, das als Teil eines kohärenten, ausdrucksstarken Ganzen zu interpretieren ist. „... Wenn Rodin die Oberfläche seiner Werke zu essenziellen Scheitelpunkten umwandelte oder wenn er einen Vorsprung verstärkte oder eine Vertiefung tiefer gestaltete, wirkte er auf sein Werk, ähnlich wie die Atmosphäre seit Jahrhunderten (auf die Tierfiguren auf Kathedralen) wirkt. [...] Mit einer lebendigen Oberfläche konnte er wie in einem Spiegel Entfernungen einfangen und in Bewegung setzen; er war in der Lage, eine Geste zu modellieren, die ihm groß erschien, und den Raum dazu bringen, Teil davon zu werden“.
Zum Thema des Körpers, den Rodin von innen heraus gründlich kannte und dessen Einheit er auf der Oberfläche darstellte, wo sich „seine Forschung fokussierte, die aus unendlichen Kontaktpunkten zwischen Licht und Materie bestand... „, wird erneut auf Rilke verwiesen. Rilke äußert zudem abschließende Beobachtungen zum Fragment, insbesondere zu den Händen: „Hände, die sich in Zorn und Wut erheben, Hände, deren fünf Finger wie bellend wirken [...]. Gehende Hände, schlafende Hände, erwachende Hände; verbrecherische Hände, schwer belastet von einer Erbkrankheit [...]. Hände haben eine Geschichte, eine Kultur, eine besondere Schönheit [...] ihre eigenen Wünsche, Gefühle, Launen und Leidenschaften“. Zusammenfassend lässt sich festhalten: „Für Rodin bildet der menschliche Körper nur dann ein Ganzes, wenn eine Bewegung [von innen nach außen] alle seine Glieder und Kräfte erweckt. Andererseits fügt er auch Teile verschiedener Körper, die durch ein inneres Bedürfnis miteinander verbunden sind, zu einem organischen Ganzen zusammen“. Garoglios Fotografien illustrieren nicht, sondern veranschaulichen die von Rilke ausgedrückten Ideen durch prägnante, wirkungsvolle Bilder. Ein Beispiel dafür sind die Aufnahmen von Rodins Skizzen zum Thema Tanz: In diesem Fall könnte ein Vergleich mit Degas Gemeinsamkeiten und Unterschiede verdeutlichen. Ein solcher Vergleich würde jedoch eine weitere Analyse des Verhältnisses zwischen Fotografie und Skulptur (oder Malerei) erfordern, insbesondere in Bezug auf die Übertragung von Zeitlichkeit und Bewegung in ein statisches Bild. In diesem Fall stünde R. M. Rilke sozusagen im Dialog mit P. Valéry.
Diesbezüglich möchte ich eine Beobachtung zu Medardo Rosso machen. Seine Figuren sind gelenklos: Es sind Köpfe ohne Körper, ohne Arme und Hände sowie ohne Beine und Füße. Vielmehr sind es Gesichter, oder besser gesagt, Masken, die das unermüdliche fotografische Auge durch geschickte Lichteinfälle hervorbringt und so die scheinbar mangelnden Gelenke enthüllt. Die Fotografie, die Rosso als objektive (objektivierende) Beschreibung ablehnt, ist für ihn ein wirksames Instrument, um die Materialität der Skulptur (wie oben erwähnt) aufzulösen, aber auch um deren Präsenz im Raum zu gestalten. Er setzt in der Fotografie gleichsam den Verbreitungs- oder Ausbreitungsprozess fort, den die von Gefühlen angeregte Energie des Modellierens in Gang gesetzt hat. Die Art und Weise, wie Angelo Garoglio plastische Objekte belebt, ist anders; in gewissem Sinne handelt es sich um eine entgegengesetzte Herangehensweise. Garoglio nutzt die sozusagen konzentrierte, sogar introvertierte Komplexität, die vom Modellierer geschaffen wird, um mit mehreren Methoden zu experimentieren. Wie ein unermüdlicher Forscher auf einem Gebiet voller Anregungen, Gelegenheiten und potenzieller Entdeckungen, konfrontiert mit verschiedenen Provokationen, insbesondere durch das Licht, im Wandel der Zeiten.
Das Licht offenbart die beständige und phantomhafte Natur der Dinge.
Die Bildhauerei reizt die Fotografie an, das plastische Bild neu zu gestalten.
Die Fotografie gibt das plastische Bild als eine reine Artikulation des Lichts wieder.
Das fotografische Bild regt zum weiteren plastischen Experimentieren an.